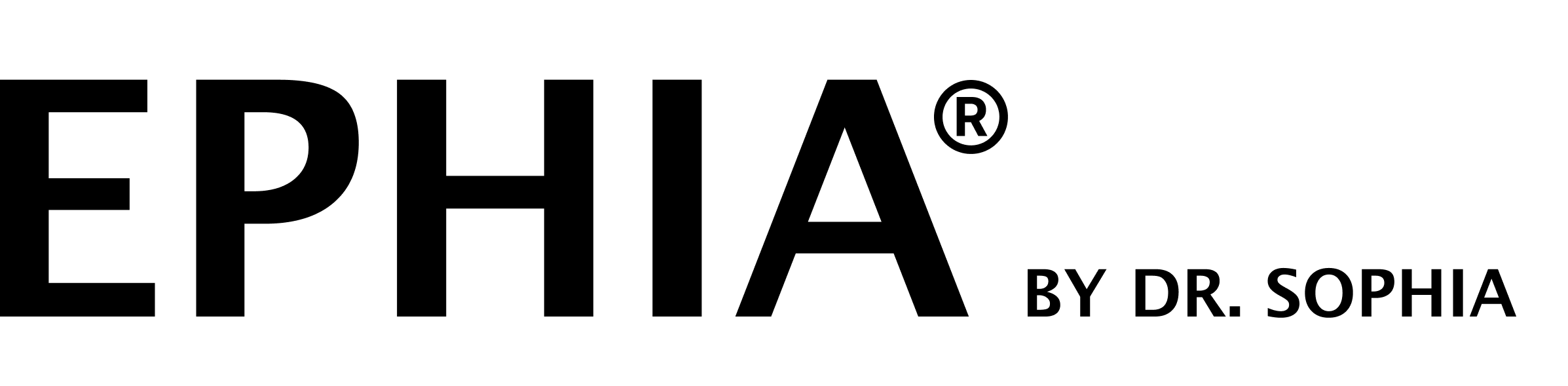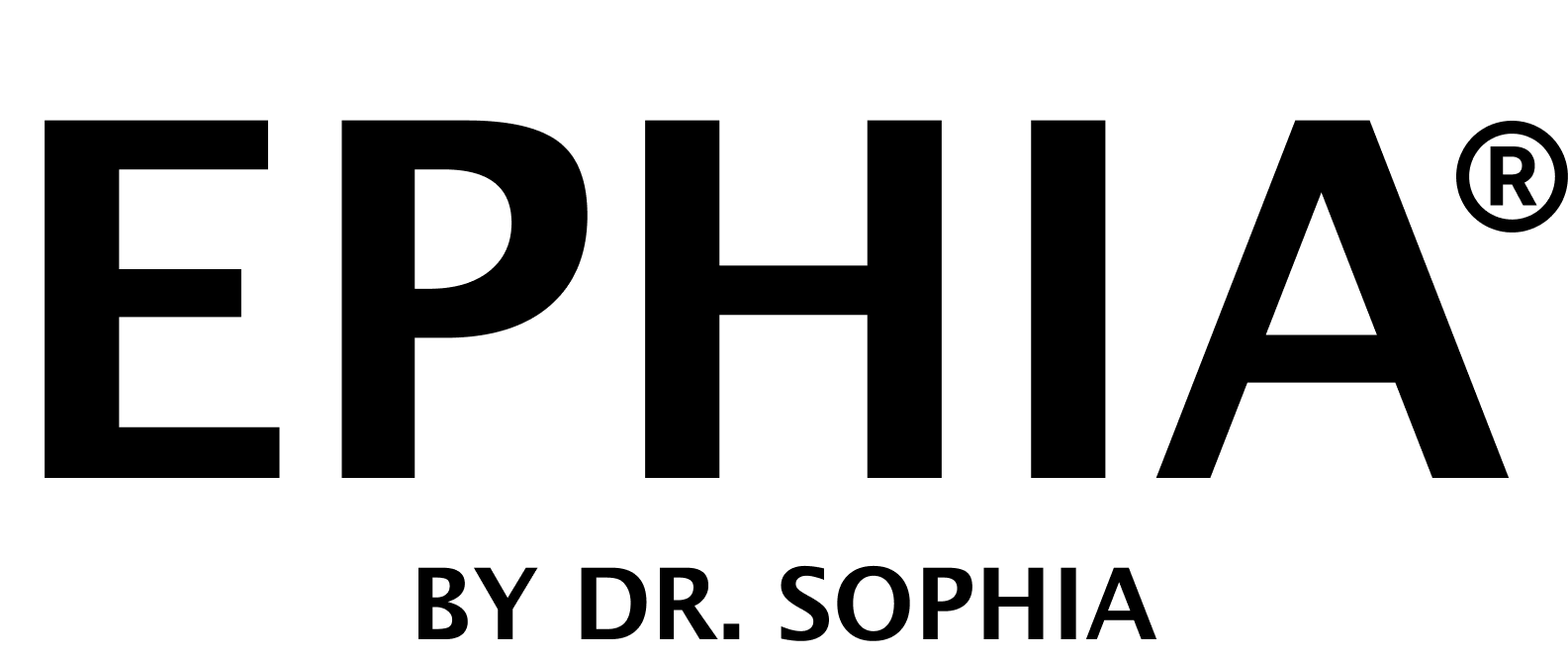Sprache schafft Räume
Im medizinischen Alltag erleben viele Ärzt:innen, dass Patient:innen sich nicht trauen, über Chemsex zu sprechen, aus Angst vor Wertung oder Unverständnis. Dabei wäre genau das Gegenteil notwendig: Räume, in denen Fragen zu Substanzgebrauch, Sexualität und psychischem Wohlbefinden ohne Scham gestellt werden dürfen. Eine diskriminierungssensible Kommunikation bedeutet, nicht nur Symptome, sondern auch Kontexte zu sehen.
Chemsex ist kein Randphänomen, sondern Ausdruck gesellschaftlicher und individueller Realitäten, in denen Sexualität, Identität und Selbstfürsorge ineinandergreifen.
Empty space, drag to resize
Ein zentraler Unterschied in der Prävalenz von Chemsex zwischen Männern, die Sex mit Männern haben (MSM), und Frauen, insbesondere lesbischen oder queeren Frauen (WSW), liegt in den sozialen und sexuellen Strukturen, in denen Sexualität gelebt wird.
Während Chemsex bei MSM häufig Teil eines gemeinschaftlichen, digital vermittelten Netzwerks ist, mit festen Substanzmustern, Gruppentreffen und einer stark sexualisierten Partykultur, fehlen solche Strukturen weitgehend im lesbischen oder queeren weiblichen Kontext. Sexualität wird hier häufiger beziehungsorientiert und weniger leistungsbezogen erlebt, und Substanzkonsum erfüllt meist andere psychosoziale Funktionen: z. B. Stressabbau, Selbstregulation oder soziale Zugehörigkeit, jedoch selten zur gezielten Verstärkung sexueller Erlebnisse.
Empty space, drag to resize
Diese Unterschiede zeigen, dass Unterstützungsstrategien differenziert gedacht werden müssen. Für MSM, die Chemsex praktizieren, stehen Harm-Reduction-Angebote, niedrigschwellige Sucht- und Sexualberatungen sowie anonyme Online-Sprechstunden im Vordergrund. Für Frauen und queere Personen hingegen braucht es zugängliche Räume für psychische und sexuelle Gesundheit, die Themen wie Selbstbestimmung, Körpererleben und Beziehungsdynamik ansprechen, ohne sie zu pathologisieren.
Kurz gesagt: Wir brauchen keine einheitliche Präventionsbotschaft, sondern kontextsensible Strategien, die Lebensrealitäten anerkennen, nicht bewerten, und Menschen unabhängig von Geschlecht oder sexueller Identität in ihrer Selbstfürsorge stärken. Das bedeutet auch, dass wir uns als ärztliche Kolleg:innen mit den Lebensrealitäten unserer Patient:innen auseinandersetzen und subkulturelles Wissen erwerben müssen.
Empty space, drag to resize
1. Georgiadis N, Katsimpris A, Vatmanidou MA, et al.
Prevalence of Chemsex and Sexualized Drug Use Among Men Who Have Sex With Men: A Systematic Review and Meta-Analysis.
Drug and Alcohol Dependence. 2025;275:112800. doi:10.1016/j.drugalcdep.2025.112800
2. Coronado-Muñoz M, García-Cabrera E, Quintero-Flórez A, Román E, Vilches-Arenas Á.
Sexualized Drug Use and Chemsex Among Men Who Have Sex With Men in Europe: A Systematic Review and Meta-Analysis.
Journal of Clinical Medicine. 2024;13(6):1812. doi:10.3390/jcm13061812
3. Hibbert MP, Hillis A, Brett CE, Porcellato LA, Hope VD.
A Narrative Systematic Review of Sexualised Drug Use and Sexual Health Outcomes Among LGBT People.
The International Journal on Drug Policy. 2021;93:103187. doi:10.1016/j.drugpo.2021.103187
4. Bohn A, Sander D, Köhler T, et al.
Chemsex and Mental Health of Men Who Have Sex With Men in Germany.
Frontiers in Psychiatry. 2020;11:542301. doi:10.3389/fpsyt.2020.542301
5. Lawn W, Aldridge A, Xia R, Winstock AR.
Substance-Linked Sex in Heterosexual, Homosexual, and Bisexual Men and Women: An Online, Cross-Sectional “Global Drug Survey” Report.
The Journal of Sexual Medicine. 2019;16(5):721–732. doi:10.1016/j.jsxm.2019.02.018