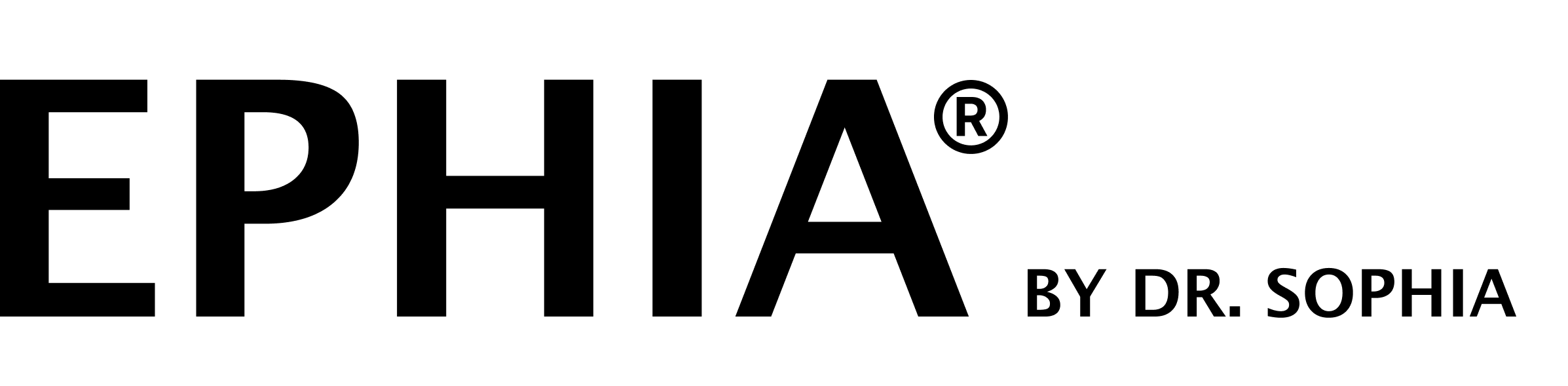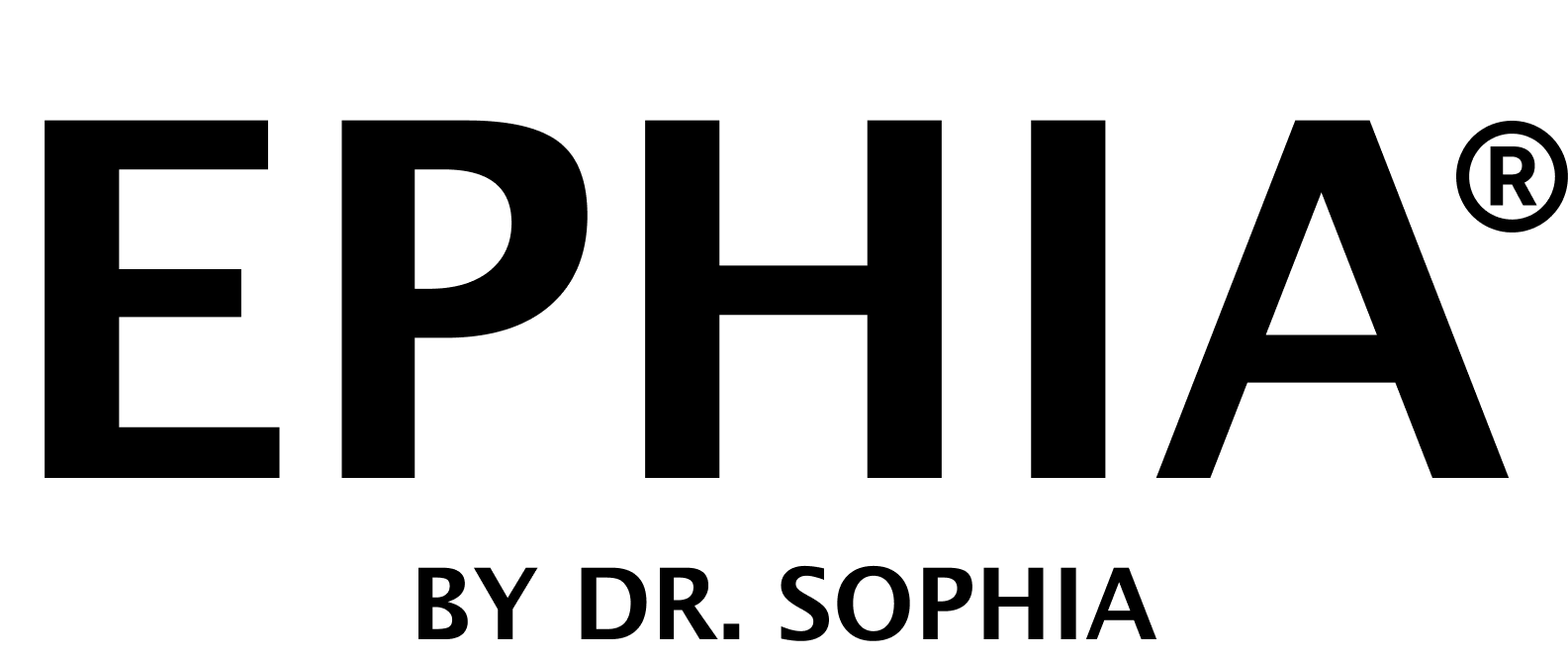Wie sich Dauerkonsum auswirkt
Die Literatur beschreibt keine festen Grenzwerte, aber eine deutliche Dosis-Wirkungs-Beziehung. Erste funktionelle Beschwerden wie Nasenbluten oder chronische Rhinitis treten häufig bereits nach einigen Monaten intensiveren Konsums ab etwa 0,5 g täglich auf. Septumperforationen entstehen laut Fallserien typischerweise nach 12 bis 36 Monaten bei täglichem Konsum von rund 0,5 bis 2 g (2). Die Entwicklung einer Sattelnase wird in der Literatur meist nach zwei bis fünf Jahren beschrieben, oft bei täglichem Konsum von 1 bis 3 g und mehrmaliger Applikation pro Tag. Eine ausgeprägte Mittelgesichtsdestruktion mit Gaumenperforationen sowie Beteiligung von Maxilla, Ethmoid und Nasenmuscheln tritt vor allem nach drei bis fünf Jahren schweren Dauerkonsums ab etwa 2 g täglich auf, insbesondere bei hohem Anteil toxischer Streckmittel (5).
Im Fall Haftbefehl, dessen dokumentierter Zeitraum sich etwa von 2022 bis Ende 2024 erstreckt, erscheinen sowohl eine Septumperforation als auch die Entwicklung einer Sattelnase plausibel und sichtbar. Schäden an Gaumen und Nasenmuscheln sind ebenfalls möglich. Der Fall verdeutlicht eindrucksvoll, wie stark chronischer Kokainkonsum das Gesicht innerhalb weniger Jahre verändern kann. Diese Veränderungen sind medizinisch gut beschrieben, pathophysiologisch nachvollziehbar und stehen in enger Verbindung mit Dosis, Dauer und Art des Konsums.
Empty space, drag to resize
Abb. 1
Das Bild zeigt eine Perforation des harten Gaumens (a) sowie ausgedehnte Nekrosen und Krustenbildungen in einer oro-nasalen Höhle, in der große Teile des harten Gaumens und des Nasenseptums (c,d) fehlen (6).
Empty space, drag to resize
Kokainkonsum hat weit mehr Auswirkungen als die lokal sichtbaren Schäden an der Nasenschleimhaut. Bei regelmäßigem oder langfristigem Gebrauch entstehen körperliche, psychische und soziale Folgen, die sich gegenseitig verstärken. Dazu gehören Herzrhythmusstörungen, Bluthochdruck, Schlafstörungen, Angstzustände, depressive Verstimmungen und ein instabiler Energiehaushalt. Viele Betroffene berichten zusätzlich von sozialer Belastung oder innerem Druck, der den Konsum weiter fördert. Diese Veränderungen entwickeln sich oft schleichend und werden von den Konsumierenden selbst lange nicht als Warnsignal erkannt. Für die ästhetische Praxis ist es deshalb wichtig, sich selbst und das Team zu schulen, um typische Hinweise zu erkennen und eine grundsätzliche Awareness für Substanzkonsumstörungen zu entwickeln.
Immer wieder auftretendes Nasenbluten, chronische Rhinitis, schlecht heilende Schleimhautläsionen, unklare Ulzerationen, Stimmungsschwankungen oder ungewöhnliche Hautveränderungen können indirekte Anzeichen für Kokainkonsum sein. Kein einzelnes Symptom beweist einen Substanzkonsum, doch das Erkennen wiederkehrender Muster hilft, Risiken besser einzuschätzen und Behandlungen sicher zu planen. Dabei ist wichtig, dass stigmatisierende Begriffe wie Drogenabhängigkeit oder Drogenmissbrauch in der modernen Fachliteratur vermieden werden und Du daher auch in Deinem Sprachgebrauch nicht führen solltest.
Die Ansprache sollte stets behutsam erfolgen. Viele Menschen sprechen ungern über ihren Konsum, oft aus Scham oder aus Sorge vor Wertung. Eine offene, einladende Gesprächssituation schafft Vertrauen, etwa wenn erklärt wird, dass bestimmte Schleimhautveränderungen bei verschiedenen Substanzen vorkommen können und diese Information für eine sichere Behandlung relevant ist. Patient:innen verstehen schnell, dass es nicht um Schuld geht, sondern um medizinische Sorgfalt und um eine Versorgung, die ihre Lebensrealitäten berücksichtigt.
Empty space, drag to resize
Viele Hilfsangebote sind heute niedrigschwellig erreichbar, besonders im urbanen Raum und zunehmend auch online. Dazu gehören anonyme Suchtberatungsstellen, ärztliche und psychotherapeutische Praxen, queersensible Beratungsangebote, HIV- und PrEP-Ambulanzen sowie digitale Unterstützungsangebote wie Onlineberatungen, Chats oder Apps zur Konsumreflexion. In größeren Städten existieren zudem spezialisierte Anlaufstellen für sexualisierten Substanzkonsum, Notfallsprechstunden sowie Einrichtungen, die Drug-Checking oder harm-reduction-orientierte Beratung anbieten. Auch Hausärzt:innen sowie psychosoziale Dienste können ein erster Kontaktpunkt sein, wenn Unsicherheit besteht oder der Konsum beginnt, den Alltag zu beeinträchtigen.
Bitte vermittele, dass Hilfe nicht automatisch Abstinenz bedeutet. Viele moderne Angebote arbeiten ressourcenorientiert, stärken Selbstfürsorge und unterstützen Menschen dabei, ihren Konsum zu verstehen, zu reflektieren und gegebenenfalls zu reduzieren. Für Patient:innen ist es entlastend zu hören, dass Beratung ohne Bewertung stattfindet und dass auch kleine Schritte, wie ein Gespräch, eine Onlineberatung oder das erste Bewusstwerden von Mustern, bereits Teil eines professionellen Unterstützungsprozesses sind.
Empty space, drag to resize
1. Trimarchi, M., Gregorini, G., Facchetti, F., Morassi, M. L., Manfredini, C., Maroldi, R., Nicolai, P., Russell, K. A., McDonald, T. J., & Specks, U. (2001). Cocaine-induced midline destructive lesions: Clinical, radiographic, histopathologic, and serologic features and their differentiation from Wegener granulomatosis. Medicine, 80(6), 391-404. https://doi.org/10.1097/00005792-200111000-00005
2. Nitro L, Pipolo C, Fadda GL, Allevi F, Borgione M, Cavallo G, Felisati G, Saibene AM. Distribution of cocaine-induced midline destructive lesions: systematic review and classification. Eur Arch Otorhinolaryngol. 2022 Jul;279(7):3257-3267. doi: 10.1007/s00405-022-07290-1. Epub 2022 Feb 9. PMID: 35138441; PMCID: PMC9130192.
3. Trimarchi M, Bertazzoni G, Bussi M. Cocaine induced midline destructive lesions. Rhinology. 2014 Jun;52(2):104-111. doi: 10.4193/Rhino13.112. PMID: 24932619.
4. Pendolino AL, Benshetrit G, Navaratnam AV, To C, Bandino F, Scarpa B, Kwame I, Ludwig DR, McAdoo S, Kuchai R, Gane S, Saleh H, Pusey CD, Randhawa PS, Andrews PJ. The role of ANCA in the management of cocaine-induced midline destructive lesions or ENT pseudo-granulomatosis with polyangiitis: a London multicentre case series. Laryngoscope. 2024 Jun;134(6):2609-2616. doi: 10.1002/lary.31219. Epub 2023 Dec 12. PMID: 38084793.
5. Howardson BO, Vérillaud B, Herman P, Marc M. Management of cocaine-induced midline lesion (CIMDL) extended to skull base: a case report and systematic review. Eur Arch Otorhinolaryngol. 2025 Sep 3. doi: 10.1007/s00405-025-09612-5. Epub ahead of print. PMID: 40900322.
6. Trimarchi, Matteo & Bertazzoni, Giacomo & Bussi, M.. (2014). Cocaine induced midline destructive lesions. Rhinology journal. 52. 104-111. 10.4193/Rhin13.112.